Donnerstag, 14 April, 2022
In dieser sechsten Episode geht es um das autonome Nervensystem. Ich beschäftige mich mit den Fragen: Warum ist es schwierig bis unmöglich, für mich alleine emotionale Probleme zu lösen? Warum reagiere ich trotz guter Vorsätze und Handlungsstrategien in bestimmten Situationen mit Stresssymptomen? Wie kann Traumatherapie helfen, besser mit Stresssituationen zurecht zu kommen?
bei iTunes abbonieren | bei Android abbonieren | bei Spotify abbonieren
youtube-Kanal abbonieren | bei amazon hören
Wie entstehen Gefühle?
In Folge 4 hatte ich erklärt, was Gefühle sind, wie sie entstehen und welche Funktion sie in unserem Leben haben. Ich hatte ausgeführt, dass Gefühle aus einem aktiven Denkprozess entstehen, der durch unsere Erfahrungen geprägt ist. Kurz gesagt hatte ich behauptet, dass wir uns so fühlen wie wir uns fühlen, weil wir auf eine bestimmte Weise denken. Ich hatte erläutert, dass eine Wechselwirkung zwischen Körperempfindungen und Gefühlen besteht. Ein Gefühl hat einerseits immer eine Körperempfindung zu Folge. Andererseits können Gefühle auch durch bestimmte Körperempfindungen ausgelöst werden.
Lassen sich Gefühle durch Denken verändern?
In Folge 5 habe ich eine Methode zur Gefühlsregulation vorgestellt. Mit dem modifizierten ABCZ-Modell der integrativen kognitiven Verhaltenstherapie kann man lernen, sein Gefühlsleben zu verändern, indem man Situationen anders bewertet. Diese Methode ist sehr „kopflastig“. Denn wir nutzen bei dieser Methode unsere Fähigkeit zum analytischen Denken und Reflektieren erlernter Denk- und Verhaltensweisen, um diese dann Schritt für Schritt zu verändern.
Und zugegeben: Nicht nur mein Freund Jürgen Heieck, der die wunderbare Musik für diesen Podcast komponiert, fragt sich zweifelnd: Funktioniert das wirklich bei jedem Menschen? Inzwischen kommen auch einige Psychotherapieforscher zu dem Schluss, dass kognitive Verhaltenstherapie bei vielen Menschen zwar zu guten Ergebnissen führt. Gleichzeitig sind sie jedoch der Auffassung, dass deren zentrale Annahme, Gefühle ließen sich alleine mithilfe des kognitiven Denkens verändern, nicht oder nur begrenzt zutrifft. Vielmehr müssten Betroffene erst neue Beziehungserfahrungen machen, die Auswirkungen auf ihre emotionale Befindlichkeit haben. Dies führe dann in der Folge zu Veränderungen des Denkens und Handelns.
Wie entstehen Glaubenssätze?
Wir Menschen sind von Beginn unseres Lebens auf andere Menschen bezogen. Unsere innere Welt wird im Kontakt zu wichtigen Bezugspersonen geprägt. Es geht nicht nur darum, dass unsere menschlichen Bedürfnisse angemessen befriedigt werden, sondern dass diese auch als berechtigt anerkannt werden. Diese Anerkennung erfolgt in kommunikativen Austausch mit anderen Menschen. Wir sind darauf angewiesen, im Gegenüber eine gefühlsmäßige Resonanz auszulösen, damit wir verstanden werden. Verläuft dieser Abstimmungsprozess größtenteils unbefriedigend, hat dies weitreichende Folgen für unser emotionales Erleben. Dies gilt besonders dann, wenn diese Frustration in den ersten Lebensjahren stattfindet. Denn ein Kind ist in seiner Existenz anhängig vom Wohlwollen der versorgenden Bezugspersonen. Ablehnung ist dann gleichbedeutend mit Vernichtung. Das Kind beginnt, sich selbst aus den Augen der anderen zu sehen. Es lernt, dass bestimmte Aspekte der Selbstäußerung und die damit verbundenen Bedürfnisse unannehmbar sind. So formen sich Glaubenssätzen wie
– „Wenn ich zornig bin, werde ich verlassen.“
– „Wenn ich weine, werden andere wütend.“
– „Wenn ich aufgeregt bin, bin ich nicht auszuhalten.“
– „Egal, was ich mache, irgendwie bin ich immer falsch.“
Wie lernt das autonome Nervensystem sich zu regulieren?
Auch die Regulationsvorgänge des Autonomen Nervensystems werden vor allem im Säuglings- und Kleinkindalter in sozialen Interaktion mit den primären Bezugspersonen, insbesondere mit der Mutter erlernt. Das Autonome Nervensystem ist für die unbewussten und unwillkürlichen Funktionen unseres Körpers zuständig, es regelt z.B. Herzschlag, Atmung, Körpertemperatur, Muskeltonus, Verdauung, Hormonhaushalt und andere lebenswichtige Vorgänge.
Die Regulation des kindlichen Organismus erfolgt in enger Anlehnung an die Mutter. Reagiert die Mutter auf bestimmte Reize der Außenwelt, z.B. laute Geräusche, ruhig und gelassen, so werden diese auch vom Kind als ungefährlich wahrgenommen. Gleiches gilt auch für Reize aus dem Inneren des Kindes: Hat es z.B. Blähungen oder Hunger und die Mutter versteht dies und kann beruhigend auf die Signale des Kindes reagieren, dann lernt auch das autonome Nervensystem des Kindes sich zu beruhigen.
Ist die Mutter aufgeregt oder ängstlich, merkt dies das Kind und reagiert darauf unwillkürlich mit einer Veränderung seines autonomen Zustands.
Den Prozess durch den Kinder die Fähigkeit entwickeln, belastende Emotionen und Empfindungen von Anfang an durch die Verbindung mit fürsorglichen und zuverlässigen primären Bezugspersonen zu beruhigen und zu bewältigen, nennt man Co-Regulation. Wir Menschen haben während unseres ganzen Lebens den Wunsch nach Co-Regulierung, auch wenn bei Menschen, die eine gesunde frühkindliche Entwicklung gemacht haben und dadurch die notwendigen Fähigkeiten verinnerlicht haben, dieser Wunsch im Laufe des Jugendalters abnimmt.
Welchen Einfluss hat das autonome Nervensystem auf unseren Körper?
Bei tatsächlicher oder gefühlter Belastung wird die nach außen gerichtete Aktionsfähigkeit erhöht. Denn unsere Muskeln benötigen Energie. Auch wenn ich hier nicht auf die genauen biochemischen Zusammenhänge eingehen möchte, meine ich mit Energie nicht den unklar definierten Begriff, der oftmals in esoterischen Zusammenhängen gebraucht wird. Sondern ich meine ganz konkret den für die menschlichen Zellen wichtigen Energieträger Adenosintriphosphat, kurz ATP. Damit diese Energie im Moment des Verbrauchs bereit gestellt werden kann, muss unser Herz schneller schlagen, wir müssen schneller und tiefer atmen, die Skelettmuskeln werden stärker durchblutet usw.
Wenn die tatsächliche oder gefühlte Belastung vorbei ist, muss sich der Organismus regenerieren. Der Blutdruck sinkt; das Herz schlägt wieder ruhiger; die Atmung beruhigt sich; Magen und Darm nehmen ihre Tätigkeit auf, damit die verbrauchte Energie wieder aufgefüllt werden kann.
Du darfst Dir dies natürlich nicht so vorstellen, dass es nur zwei Zustände (aktiv oder passiv) gäbe. Es ist vielmehr ein fein abgestimmter Prozess, der sich mal mehr, mal weniger in die eine oder andere Richtung verschiebt.
Welchen evolutionären Hintergrund hat die autonome Regulation?
Der Regulationsprozess des vegetativen Nervensystems hat einen evolutionären Hintergrund: Überlebt haben die Spezies, die in der Lange waren, einer drohenden Gefahr passend zu reagieren. Kampf oder Flucht (engl. „fight or flight“) war eine Möglichkeit. Dazu musste, wie eben erläutert, Energie mobilisiert werden. Kämpfen war nur dann erfolgreich, wenn man stärker war als ein Angreifer. Ansonsten war Flucht die erfolgreichere Strategie.
Eine dritte Überlebensstrategie war und ist das Totstellen, auch „shutdown“ oder „freeze“ genannt. Wenn die Kraft weder zum Kampf oder noch zur Flucht ausreicht, dann erfolgt vom autonomen Nervensystem eine Regualtion in die krass gegenteilige Richtung, in eine Art „Energiesparmodus“. Dieser kann evolutionär vielleicht so erklärt werden, dass ein hungriges Raubtier das Interesse an einem bereits toten Tier verliert oder es erst gar nicht bemerkt. Auch in Zeiten der Dürre wie im Winter oder wenn man in einer Höhle verschüttet war, konnte das Ausharren in einem auf Energiesparen ausgerichteten Zustand ein überlebensichernder Vorteil sein.
Nun gibt es neben diesen drei evolutionären Überlebensstrategien Kampf-Flucht und Totstellen noch eine vierte: Kooperation. Wenn ein Individuum nicht stark genug war, um sich alleine gegen Gefahren zu behaupten, sich jedoch mit anderen Individuen auf irgendeine Weise zusammenarbeitete, so konnte es trotzdem das Überleben sichern. Um mit anderen zu kooperieren ist eines notwendig: Kommunikation. Denn das einzelne Individuum muss sein Verhalten mit dem der anderen Abstimmen. Erst durch Kommunikation wird aus dem individuellen Verhalten koordiniertes soziales Handeln.
Polyvagaltheorie?
Nach Auffassung der Polyvagaltheoie ist für die Kooperations-Strategie ein Regulationszustand unseres autonomen Nervensystems notwendig, der es möglich macht, mit anderen Menschen nicht nur durch Sprache, sondern auch durch Körperhaltung, Mimik und Gestik zu kommunizieren. Es ist eine Art mittlerer Modus zwischen nach außen gerichteter Aktivität des Kampf-oder-Flucht-Modus und passiver innerer Zurückgezogenheit eines „Shutdowns“.
Es ist wie ein Möbiusband oder die Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt: Denn nur wenn wir uns sicher genug fühlen – oder besser gesagt unser autonomes Nervensystem – können wir in kooperativen sozialen Austausch treten. Gleichzeitig vermittelt uns kooperativer sozialer Austausch ein Gefühl von Sicherheit.
Evolution oder Lebensgeschichte?
Auf welche äußeren oder inneren Reize unser Nervensystem überhaupt mit einer Veränderung des autonomen Zustands reagiert – und wenn auf welche Weise – ist zum einen evolutionär bedingt: Die Furcht vor bestimmten Tieren – z.B. Schlangen oder Spinnen – oder Situationen wie Höhe, enge, geschlossene Räume, sicherte in der stammesgeschichtlichen Entwicklung das Überleben der menschlichen Spezies und ist damit aus evolotionsbiologischer Sicht eine sinnvolle Reaktion. Auch bestimmte tiefe Geräusche mit Frequenzen, die an das Donnergrollen eines Gewitters, Erdbebens oder Vulkanausbruchs erinnern, sind dazu geneigt, unser Nervensystem zu einer Stressregulation zu veranlassen, … während Töne mit einem Frequenzspektrum ähnlich der menschlichen Sprache, Gesang oder Holzblasinstrumente, beruhigend wirken. Was wir als Gefahr und damit als Stress wahrnehmen, hängt damit zusammen, wie wir eine Situation bewerten, also mit unserem inneren Weltbild. Unser inneres Weltbild hat sich durch soziale Interaktion geformt. Damit es sich verändern kann, bedarf es also wiederum sozialer Interaktion. Was heißt das alles nun konkret für jemanden, der sein Fühlen, Denken und Handeln verändern möchte? Es heißt, dass sich viele emotionale Probleme sich nicht auf befriedigende Weise alleine im stillen Kämmerlein lösen lassen – weder durch bestimmte Techniken und noch weniger durch durch analytisches Nachdenken. Das gilt im besonderen bei sogenannten psychosomatischen Beschwerden, also körperlichen Beschwerden, für die es keine medizinisch diagnostizierbare organische Ursache gibt. Was es braucht ist das emotionale Mitschwingen eines Gegenübers, der Raum gibt, auszudrücken und Worte zu finden für das, was bisher nur diffus wahrnehmbar war – nur spürbar – spürbar vielleicht allein über diffuse Körperempfindungen. In der Therapie reicht es nicht aus, über belastende Situationen inhaltlich zu sprechen und mit dem analytischen Verstand nach wünschenswerteren Denk- und Handlungsweisen zu suchen. Für eine Veränderung muss der Körper bzw. die autonomen Regulationsvorgänge des Nervensystems mit einbezogen werden. Dies geschieht im besonderen in einer körperorientierten Traumatherapie. Musik: Literaturhinweise:
Zum anderen spielen lebensgeschichtliche Lernprozesse eine Rolle, wie das autonome Nervensystem des einzelnen reagiert, d.h. ob, in welche Richtung und wie stark sich das Gleichgewicht zwischen leistungsfördernder und regenerativer Prozessen in bestimmten Situationen verschiebt. Auch wie schnell es sich nach einer Stressbelastung wieder soweit in den „Mittleren Modus“ einpendelt, in dem kooperative Kommunikation möglich ist, ist eine Anpassungsleistung, d.h. hier ein Lernprozess.
Die Einschätzung unserer Lage, ob wir uns sicher oder bedroht, stark und der Situation gewachsen oder schwach fühlen, findet auf der Ebene des autonomen Nervensystems statt. Dies geschieht sehr schnell, ohne dass wir großartig Zeit haben, die Situation durch Nachdenken zu analysieren. Zu welcher Einschätzung wir gelangen ist abhängig von unseren Ressourcen, also ob wir uns also einer Situation mit unseren Fähigkeiten gewachsen fühlen oder nicht.Lassen sich emotionale Probleme alleine lösen?
Wie funktioniert körperorientierte Traumatherapie?
Das Erleben, das der Klient verändern will, muss in der Therapiestunde unmittelbar spürbar werden. Da dieses Erleben mit sozialen Situationen zusammenhängt, müssen Therapeut und Klient ihre Aufmerksamkeit auf das richten, was in diesem Augenblick, also zwischen ihnen in aktuellen sozialen Situation vorgeht. Wenn der Klient merkt, welche psychischen Aktivitäten dies in ihm hervorruft, entsteht eine Verdichtung in seinem Erleben. Er nimmt deutlicher und emotional intensiver wahr. Dies führt unweigerlich auch zu einer Veränderung des autonomen Regulationszustands, die der Klient körperlich spürt. Diese körperlichen Reaktionen kann der Therapeut wiederum aufgreifen.
Die wertschätzende Einladung des achtsamen Wahrnehmens und respektvollen Erforschens der belastenden Gefühle und den damit verbundenen körperlichen Vorgängen bewirkt eine Beruhigung und damit eine Veränderung über den schon angesprochenen Mechanismus der Co-Regulation.
Hilfreich ist dafür die warme, ruhige Präsenz des Therapeuten, der auf die sich verändernden emotionalen und körperlichen Signale seines Klienten achtet und gleichzeitig in der Lage ist, seinen eigenen emotionalen und physiologischen Zustand zu regulieren. Der Klient merkt, dass sein Gegenüber sein „So-in-der-Welt-Sein“ wahrnimmt und akzeptiert. Er bekommt inmitten seiner emotionalen Erregung gefühlsmäßig passende Antworten. Mit Antworten meine ich nicht ausschließlich den Inhalt gesprochener Sätze, sondern auch die Art, WIE etwas gesagt wird. Es beinhaltet Tonfall und Lautstärke der Stimme, Mimik, Gestik und Körperhaltung. Auch Schweigen kann manchmal eine passende Antwort sein. Eine Antwort muss auf der emotionalen Beziehungsebene passen.
Wenn wir nun davon ausgehen, dass die emotionalen Probleme des Klienten durch frühere Beziehungserfahrungen entstanden sind, dann fallen die Antworten des Therapeuten anders aus als erwartet. Auf diese Weise ist er mit einer neuen Erfahrung konfrontiert, die nicht so recht in sein bisheriges Weltbild passt. Es ist so, als ob neue Puzzelsteine dazu kommen, die irgendwie mit eingepasst werden müssen. Alte Steinchen werden ausgetauscht. So verändert sich das innere Weltbild. Und weil dies geschieht, kommt es zu Veränderungen des eigenen Erlebens. Vielleicht sind diese Veränderungen anfangs noch sehr klein. Doch da sie Veränderungen des eigenen Verhaltens nach sich ziehen, bewirken sie auch Veränderungen in der Interaktion mit anderen Menschen, die wiederum auf mich zurückwirken.
Und so können kleine Anstöße, die man in der Therapie oder Coaching bekommt, nach und nach größere Veränderungen im Leben nach sich ziehen.
Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, wieso bestimmte Methoden, die im Kontext einer Psychotherapie oder eines Coachings funktionieren und hilfreich sind, um positive Veränderungen im Fühlen, Denken und Handeln zu bewirken, während sie vielleicht wirkungslos bleiben, wenn Du sie zuhause für Dich alleine anwendest. Eine Methode oder Technik ist häufig eben nur so etwas wie das Bindeglied im sozialen Kontakt zwischen zwei Menschen. So wie das Schachbrett und die Figuren nicht das Schachspiel ausmachen, das zwischen zwei Spielern entsteht. Das Schachspiel lebt durch die Züge der Spieler. Jeder Zug eines der Beteiligten ist eine Antwort auf den des Anderen, für sich allein nicht verständlich, sondern erst im Zusammenhang der Interaktion.
Abonniere meinen Audio Podcast:
![]()
![]()

Abonniere meinen youtube-Kanal:

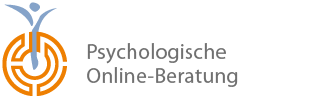

Schreibe einen Kommentar